„Es waren die lehrreichsten Wochen meines Studiums!“

Mehr als 50 Medizinstudierende meldeten sich zu Beginn der Corona-Pandemie freiwillig als Pflegehilfskräfte auf den MHH-Stationen, um das Personal zu entlasten. Ein Gespräch mit drei MHH-Studierenden über ihre Erfahrungen zu viel Desinfektionsmittel, besondere Erziehungsmaßnahmen der Pflegenden und mögliche Lehren für das Studium an der MHH. Onno Becker (25) und Maren Tinne (26) arbeiteten im April und Mai auf der COVID-19-Intensivstation, Lennart Simon (25) half auf der normalen Intensivstation 81 aus.
Frage: Warum haben Sie sich entschieden, als freiwillige Pflegehilfskräfte während der Corona-Pandemie zu helfen?
Maren Tinne: Die Universität hat im März den Lehrbetrieb vorübergehend eingestellt, daher habe ich mich für diesen Einsatz gemeldet. Ich wollte meine Zeit sinnvoll nutzen und helfen.
Lennart Simon: Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, zu helfen, wenn ich darum gebeten werde. Da ich als AStA-Vorsitzender dieses Angebot mit organisiert habe, wollte ich natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Onno Becker: Ich habe mich ebenfalls verpflichtet gefühlt, zu helfen und mein medizinisches Wissen einzubringen. Da ich nicht zu den Risikopatienten gehöre, hatte ich auch keine Bedenken, mich für diesen Einsatz zu melden.
Frage: Hatten Sie Angst, sich bei diesem Einsatz anzustecken?
Maren Tinne: In den ersten Tagen hatte ich schon Bedenken, aber die waren schnell weg, nachdem ich mich mit den Sicherheitsmaßnahmen und der Schutzausrüstung vertraut gemacht hatte. So gut geschützt wie da bin ich nirgendwo. Einen gesunden Respekt vor dem Corona-Virus habe ich aber nach wie vor, den sollte man auch unbedingt haben.
Onno Becker: Ich habe mich am Anfang etwas unwohl gefühlt und habe meine Hände etwas zu lange in Desinfektionsmittel gebadet (lacht). Mit der Zeit bin ich dann lockerer, aber nicht unvorsichtig geworden.
Lennart Simon: Ich kenne ähnliche Situationen aus meiner Zeit als Rettungssanitäter. Dabei wusste ich auch nie, was die Patienten haben und ob sie ansteckend sind. Daher war ich auf diese Situation gut vorbereitet.
Frage: Was durften Sie auf den Stationen machen, wo konnten Sie helfen?
Maren Tinne: Es ging nicht darum, Pflegekräfte zu ersetzen, sondern etwas anzureichen und damit die Pflegerinnen und Pfleger zu entlasten. Sonst hätten sie sich die Schutzkleidung immer wieder an- und ausziehen müssen, wenn sie das Patientenzimmer verlassen und erneut betreten. Wir haben Medikamente reingereicht, Blutgasanalysen gemacht und die Ergebnisse direkt zurückgegeben, damit die Pflegekräfte im Zimmer die Beatmungsgeräte richtig einstellen konnten.
Onno Becker: Zusätzlich konnten wir beim Lagern, Waschen und bei der Körperpflege der Patienten helfen. Besonders bei übergewichtigen Patienten war ein zweites Paar helfender Hände immer willkommen. Mit der Zeit konnten wir Aufgaben immer selbstständiger erledigen. Insgesamt kann man unsere Aufgaben unter dem Begriff Zuarbeitung gut zusammenfassen.
Lennart Simon: Wir wurden als Studierende nicht nur auf den COVID-19-Stationen eingesetzt, sondern auch auf anderen, normalen Stationen. Ich war auf der Intensivstation 81, auf der die Intensivpatienten aufgefangen wurden, die auf der COVID-19-Station nicht mehr betreut werden konnten. Daher hatte ich keinen direkten Kontakt zu diesen Patienten, aber auch ich konnte sehr intensiv am Patienten arbeiten. Ich habe in den acht Wochen mehr praktisch gelernt als im gesamten Studium (lacht). Ich habe Patienten von morgens bis abends mit einer Pflegeaufsicht zusammen betreut und dabei Medikamentengabe und Dosierungen kennengelernt, Applikationen vorbereitet und mich mit Beatmungsgeräten vertraut gemacht. Zusätzlich durfte ich unter ärztlicher Aufsicht auch Aufgaben meiner späteren Tätigkeit üben. Zum Beispiel habe ich das Legen einer Arterie übernommen oder bei einer Kurznarkose mit Intubation geholfen. Das lernt man auch im Studium, aber wenn man dann vor dem Patienten steht und es selber macht, wendet man die Handgriffe nach ein paar Wochen viel routinierter an. Ich hatte natürlich Glück, dass ich auf einer Intensivstation eingesetzt wurde, wo die medizinisch spannenderen Fälle sind.
Onno Becker: Ja, das war unser Glück. In den intensivmedizinischen Bereich bekommen wir während des Studiums sonst kaum Einblick. Wir absolvieren zwar ein Pflegepraktikum, aber das findet im Regelfall auf einer Normalstation statt. Auch im Pflegepraktikum habe ich viel gelernt und gute Einblicke in die pflegerische Versorgung der Patienten und Patientinnen bekommen. Die Versorgung der Intensivpatienten empfand ich jedoch deutlich komplexer und interessanter.
Lennart Simon: Das stimmt. Außerdem war der Vorbehalt in der Pflege gegenüber Studierenden vorher sehr groß. Es gab seit Jahren keine studentischen Aushilfskräfte mehr auf den Intensivstationen, weil die Pflege die Erfahrung gemacht hat, dass die Studierenden nur kurz da sind und dann eher Arbeit machen als Nutzen bringen. Doch durch Corona und unseren Einsatz auf den Stationen hat sich die Sicht der Pflegekräfte auf die Studierenden verändert. Der Chef der Anästhesie plant jetzt, wieder regelmäßig studentische Hilfskräfte beim Reha-Notfallteam einzusetzen. Die Pflegenden haben gemerkt, dass wir sehr wohl helfen können, wenn wir eingearbeitet werden und länger auf den Stationen bleiben. Sie haben sich auch immer mehr getraut, Aufgaben abzugeben. Wir waren sozusagen in einer Art Brückenposition, da wir einerseits die Pflege unterstützt haben, andererseits durch die Ärztinnen und Ärzte immer wieder als baldige Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen wurden.
Onno Becker: Das Gefühl hatte ich auch. Am Anfang waren die Pflegekräfte eher skeptisch, nach dem Motto: "Was soll ich jetzt mit dir?" Aber nach ein paar Wochen haben sie gemerkt, wie wertvoll unsere Hilfe ist und sich schon fast darum gestritten, wem wir als erstes helfen können. Am Ende waren einige traurig, als unser Einsatz beendet war.
Maren Tinne: Ich habe im Mai beim Pflegestärkungsteam nachgefragt, ob ich nicht auch neben dem Studium stundenweise weiterarbeiten könnte. Erst wurde es verneint, aber dann hat man sich entschieden, es zu probieren. Daher arbeite ich jetzt als studentische Hilfskraft weiter auf der Intensivstation, auf 450-Euro Basis. Das soll erst einmal ein Pilotprojekt für den Sommer sein, worüber ich mich sehr freue. Ich hoffe natürlich, dass das dann fortgesetzt und ausgeweitet werden kann.
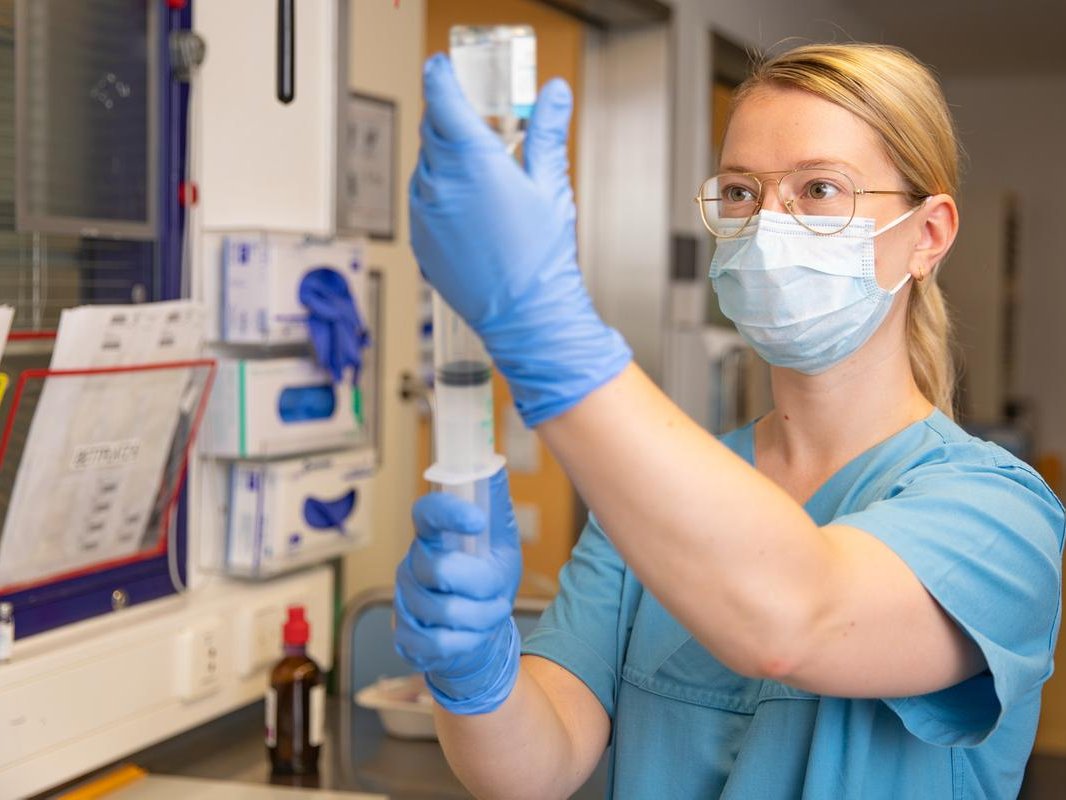
Frage: Was hat Ihnen das Pflegehilfspraktikum für Ihr Studium gebracht?
Maren Tinne: Es hat mir sehr viel gebracht. Ich fühle mich jetzt bestätigt in meinem Berufswunsch. Ich habe in diesen paar Wochen so viel so komprimiert gelernt wie noch nie vorher in meinem Studium, das wünsche ich auch meinen anderen Kommilitonen.
Lennart Simon: Es waren aber auch acht Wochen, in denen ich von der Pflege auf nette Weise erzogen wurde, weil sie mir noch einmal kurz vor Ende meines Studiums mitgeben konnten, worauf es in der Praxis ankommt. Vor allem haben sie mir mitgegeben, dass es wichtig ist, sich immer wieder mit Namen vorzustellen, wenn man einen Raum betritt und mit bisher unbekannten Personen zusammentrifft. Sobald man das verinnerlicht und Vertrauen aufgebaut hatte, durfte man praktisch mehr üben als in jeder Famulatur. Und sie haben mir die Hausregel beigebracht, dass man immer etwas Süßes mitbringen muss, wenn man etwas Neues gelernt hat. (lacht)
Onno Becker: Für mich war die Kommunikation auf der Station 14 (Anm. d. Red.: COVID-19-Station) herausragend gut, besonders zwischen Ärzten und Pflegenden. Es war eine Kommunikation auf Augenhöhe, ein Arbeiten Hand in Hand. Beide Seiten haben sich gegenseitig Arbeit abgenommen, das funktionierte besonders in Stresssituationen sehr gut. Dadurch hat die Arbeit allen mehr Spaß gemacht. Das möchte ich auf jeden Fall für mein Berufsleben als Arzt mitnehmen.
Frage: Welche Erfahrungen nehmen Sie persönlich aus dieser Zeit mit?
Lennart Simon: Dass ich mich erst einmal zwei Wochen auf einer Station beweisen muss. Ich wollte nicht einfach nur zuhören, sondern auch mit anpacken und helfen. Dazu muss man dann selbstständig nachfragen und zeigen, dass man es kann. Es war schön zu sehen, dass man sich dadurch Anerkennung verdienen kann. Ich hatte zwischendurch ein Schild „Mädchen für Alles“ an mir kleben, damit ich möglichst viel Einblick bekomme.
Maren Tinne: Bis zum vierten Studienjahr hatte ich keinen Einblick in die Intensivmedizin, daher hatte ich zu Beginn einige Bedenken, als ich dort zugeteilt wurde. Ich wurde aber zum Glück auf der Station 14 sehr herzlich empfangen und hatte einen super Pflegeanleiter, der mir geholfen hat, meine anfängliche Skepsis zu überwinden. Dadurch habe ich mich von Mal zu Mal wohler gefühlt. Im Mai hat es mir dann sogar gefehlt, da ich mich da um meine Prüfungen kümmern musste. Daher freue ich mich, dass ich jetzt weiterarbeiten kann.
Onno Becker: Für mich war noch ein wichtiger Punkt, mich emotional auf so schwer kranke Patienten einzulassen. Viele Pflegekräfte hatten keine Zeit für ein Gespräch mit den Patienten. Ich habe mir die Zeit genommen, mich viel mit ihnen zu unterhalten und dabei gelernt, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen.
Lennart Simon: Ja, es war wichtig, den Patienten zuzuhören und ihnen Zeit zu schenken. Vor allem, da sie in dieser Zeit auch ihre Angehörigen nicht sehen konnten. Ich habe einmal für einen Patienten ein Kartenspiel mitgebracht, das hat uns beiden viel Spaß gemacht. Man muss aber auch noch einmal sagen, dass uns dieses Mal eine Aufwandsentschädigung gezahlt wurde, das hat natürlich auch unsere Motivation erhöht.
Maren Tinne: Das stimmt. Leider ist das ein großes Problem im Medizinstudium, dass wir für unseren Einsatz nicht entlohnt werden. Das ist auch beim Pflegepraktikum und dem Praktischen Jahr so. Wenn man unsere Arbeit mehr wertschätzen und entlohnen würde, wäre uns sehr geholfen
Lennart Simon: Leider hatten wir - entgegen der vorherigen Zusage durch die Politik - Probleme mit der Anerkennung des Pflegehilfspraktikums als Famulaturen von Studierenden, die in der Pandemie ausgeholfen haben. Als das Online-Semester am 20. April gestartet ist, konnten viele nicht mehr weiter machen, ihnen fehlten nur wenige Tage für eine Anerkennung als Famulatur oder Pflegepraktikum. Hier hätten wir uns mehr Entgegenkommen und Sicherheit gewünscht. Daher haben wir einen offenen Brief an die Ministerien geschickt, indem wir auf das Problem aufmerksam machen. Die Studierenden, die trotz asynchronem Semesterstart weiter auf den Stationen ausgeholfen haben, sollten für diese Doppelbelastung nicht bestraft werden.
Das Gespräch führten Bettina Dunker und Vanessa Meyer
Video

Corona-Update: Medizinstudierende helfen in der Pflege
Unsere Pflegenden bekommen in dieser Zeit viel Unterstützung von Medizinstudierenden, die in dieser besonderen Situation aushelfen. Eine Studierende berichtet von ihren Erfahrungen.